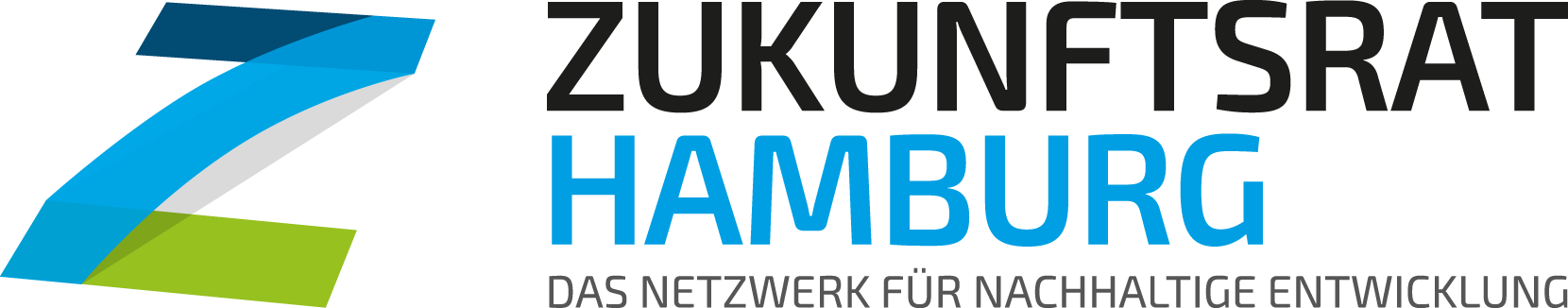Am 20. Oktober 2020 hatten wir fachkundige Gäste zum Thema Bürgerbeteiligung in Hamburg zu einer Online-Diskussion eingeladen. Aufhänger war der Vorschlag des Zukunftsrats an die Bürgerschaftsfraktionen, sich dieser Frage im Rahmen einer innovativen Enquete-Kommission „Nachhaltige Zukunftsentwürfe“
Nachfolgend eine Zusammenfassung der Kernaussagen aus den Impulsreferaten unserer Gäste sowie eine komprimierte Wiedergabe der Fragen der Teilnehmer und Antworten dazu.
- Kernaussagen aus den Impulsreferaten unserer Gäste
- Was wurde diskutiert? – Fragen und Antworten
Kernaussagen aus den Impulsreferaten unserer Gäste
Dr. Ute Scheub — Politologin, Journalistin und Buchautorin
Wir stecken in einem globalen Jahrtausendumbruch, dessen Ausmaße wir noch gar nicht abschätzen können. Die mehrfachen Krisen der Gegenwart sind weniger Ursachen als vielmehr symptomatischer Ausdruck der Hybris, dass der Mensch die Natur endlos unterwerfen, ausbeuten und vermarkten könnte, statt sich als Teil der Natur zu verstehen. Das alte Wirtschaftsmodell stößt unweigerlich an die planetaren Grenzen und so stehen wir vor dem Übergang von einer egozentrischen Betrachtung der Welt hin zu einem geozentrischen Blickwinkel.
Das Neue ist erst schemenhaft erkennbar, was bei vielen Menschen Verwirrung, Verleugnung, Abwehr und Statusangst auslöst — mit dem Rechtspopulismus als eines der sichtbarsten Zeichen. Solche Bewegungen kann man aber durchaus als Reaktionen auf gesellschaftlichen Fortschritt wie etwa Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und zwischen Völkern betrachten. Da sie selbst eine Gefährdung für die etablierten Demokratien darstellen, verängstigen sie wiederum Politiker*innen; eine Mitsprache für den Pöbel wollen sie vermeiden. Verständlich, aber solche reflexhaften Ausgrenzungen zwischen Regierenden und Regierten stellen eine Verweigerung von Resonanz dar.
Demokratie ist aber ein körperliches Bedürfnis, die eigene Stimme einzusetzen, wie es die Begriffe Selbst- und Mitbestimmung, Anstimmen, Abstimmen, Zustimmen, Übereinstimmen etc. zum Ausdruck bringen. Man kann die Stimme als ein regelrechtes Lustorgan begreifen; sie nicht einsetzen zu dürfen, macht ihre Besitzer depressiv oder aggressiv. Die Lösungsansätze der Rechtspopulisten vermögen hier nicht weiterhelfen, denn sie streben eine Gleichschaltung zum einstimmigen Resonanzkörper an. Ergebnis wäre trostlose Monotonie, die wiederum andere Stimmen unterdrücken oder gar mit Gewalt und Zwang ausschalten würden.
Das alte parlamentarische System reicht für das kommende Zeitalter und seine Herausforderungen nicht mehr aus. Benötigt wird vielmehr eine Vorwärtsverteidigung der Demokratie durch Erweiterung statt Eingrenzung. Die Politik darf sich nicht einkapseln, sondern muss sich öffnen. Da ist ein Schmetterling, der schlüpfen will, der die Puppe sprengen wird. Daher ist die Initiative des Zukunftsrats, eine Enquete-Kommission zur Institutionalisierung erweiterter Bürgerbeteiligung einzusetzen, sehr begrüßenswert.
Dr. Hans-Joachim Menzel — Jurist, Autor, Mitgründer und langjähriger Sprecher des Zukunftsrats
Ausgehend von der Hamburger Verfassung, gab Menzel einen Überblick über die in Hamburg vorhandenen Bürgerbeteiligungsinstrumente. Angefangen mit der Wahl (Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre beabsichtigt) über Petitionen, die auf Online-Formen ausgeweitet werden sollen, bis zu den Volks- und Bürgerinitiativen sowie Bürgerschaftsreferenden, die ja eine Mitbestimmung der Bürger*innen einschließen. Die Beteiligung der Bürger*innen durch die Verwaltung ist bisher durch die Deputationen, deren Abschaffung im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Ersatz soll ein Verfassungsauftrag für eine bürgernahe und transparente Verwaltung liefern. Es wird Bezug auf das gerade novelliert Transparenzgesetz genommen, aber da ist auch der Aufhänger für mehr Beteiligung gerade in der Verwaltung.
Darüber hinaus ist Bürgerbeteiligung spezialgesetzlich bzw. bundesgesetzlich durch Beratungsgremien mit Recht zur Anhörung und Stellungnahmen wie etwa im Baurecht, Wegerecht, Umweltrecht und in der Stadtentwicklung geregelt. Ergänzend kommen informelle Gremien wie z.B. die StadtWerkstatt vor, die jedoch mehr den Charakter von Erklärungs- und Informationsformaten haben.
Aber die vorliegende Initiative beschränkt sich nicht nur darauf, wie Bürgerbeteiligung gestaltet werden soll, sondern auch wozu. Die großen Zukunftsfragen von Klima über Pandemie bis zum Radikalismus sind keine rein staatlichen Fragen, sondern gesamtgesellschaftliche Fragen, die ohne eine gewichtige Stimme der Bürger*innen nicht zu lösen sind. Hamburg hat im Jahr 2017 den Umsetzungsplan der Agenda 2030 für die Nachhaltigkeitsziele der VN verabschiedet. Angekündigt waren bis Ende 2018 eine Zwischenbilanz und ein Monitoringsystem mit Indikatoren, Zielwerten und Statistiken vorzulegen. All das ist bis heute nicht erfolgt. Dies ist in dem Kontext des heutigen Themas wichtig, denn der Umsetzungsplan sah auch ein zivilgesellschaftliches Gremium vor, das die Umsetzung kritisch begleiten sollte. Dieses Gremium – das Nachhaltigkeitsforum Hamburg – arbeitet seit zwei Jahren, hat Vorschläge für solche Indikatoren vorgelegt, aber so gut wie keine Resonanz seitens des Senats erfahren.
Der Koalitionsvertrag nimmt Bezug auf die gesellschaftliche Transformation und die essentielle Teilhabe junger Menschen und liefert einen weiteren Anknüpfungspunkt für die Forderungen nach mehr Beteiligung der Bürger*innen.
Schließlich enthält die Hamburger Verfassung das Instrument einer Enquete-Kommission „zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe“. Die Nachhaltigkeitsziele der VN sind unbestreitbar ein solcher Sachkomplex. Aus der Vergangenheit ist eine Enquete-Kommission bei vielen mit der Vorstellung von Sachverständigen mit Professor- oder Doktortiteln. Aber hier könnte man ja bereits bei der Zusammensetzung neue Wege gehen und etwa Bürgerräte mit einbeziehen. Man kann es auch als Zielstellung einer Enquete-Kommission ansehen, solche Instrumente zu gestalten und zu etablieren. Es geht also nicht um fertig formulierte Antworten, sondern um ein Instrumentarium, wie man die Zukunftsfragen fortlaufend mit Politik und ZG erarbeiten kann.
Was wurde diskutiert? – Fragen und Antworten
(1) Potential für Spaltung
Frage: Kann es bei Bürgerräten nicht auch ein Potential für Spaltung geben? Es gibt doch sicher auch Beispiele für gescheiterte Bürgerräte?
Antwort: Alle Beispiele von Bürgerräten zeigen, dass Bürger*innen, die per Zufall reinkommen, sich wirklich freuen eingeladen zu sein und zur Lösung beitragen wollen. Es gibt keine bekannten Beispiele für Bürgerräte, die an Spaltung gescheitert wären. Alle Meinungen sind zugelassen, aber die Bürger*innen finden in aller Regel zu einem Konsens.
(2) Informationsstand der Beteiligten
Frage: Kann ein Bürgerrat sicherstellen, dass die Beteiligten über die Themen informiert sind, die zur Debatte stehen? Wie sollen die Bürger*innen sachverständig werden?
Antwort: Ein Bürgerrat stellt vor allem einen Lernprozess zu einem Thema dar. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Bürger stark in die Thematik vertiefen. In den Prozess sind auch Expert*innen einbezogen, die unterschiedliche Sichtweisen zum Thema vortragen. Die Bürger*innen werden zu Sachverständigen. Dies setzt natürlich einen qualitativ gut strukturierten und moderierten Prozess voraus. Dafür gibt es spezialisierte Institute. Im Gegensatz zu den Debatten, die nach der Parteilogik und Fraktionsdisziplin ablaufen, gelangen die Bürgerräte durch Dialog und Abwägen zu einem Konsens. Gleichzeitig lösen die Bürgerräte bei den Teilnehmer*innen ein Demokratieerlebnis aus, das sie sonst fast nie erfahren. Bei jeder Wahl wird den Bürger*innen auch der nötige Sachverstand und Urteilskraft zugetraut.
(3) Themenauswahl für Bürgerräte
Frage: Wie kommt man zu einer Auswahl der wesentlichen Themen und die Hintergründe und Ursachen dafür? Wie bringt man die Kompetenzen der Hamburger zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen und die Bürger*innen miteinander in Verbindung?
Antwort: Je nachdem, wie allgemein oder wie speziell die Fragestellung an den Bürgerrat formuliert wird, lässt sich ein Bürgerrat unterschiedlich gestalten. Die Anforderungen an die Moderation sind dann auch unterschiedlich und der Dialog wird unterschiedlich verlaufen. Ein großes Thema kann auch in mehrere Teilfragen unterteilt werden. Je größer das Thema, desto mehr geht es um Werte, je kleiner das Thema, desto näher ist man an konkreten Handlungsempfehlungen. Die vielen Bürgerräte haben sehr verschiedenartige Themen behandelt. Sie lassen sich von lokal oder regional über national oder international bis global zuschneiden. Auch die großen Themen eignen sich hervorragend. Das Besondere ist ja gerade, dass Bürgerräte gesellschaftliche Konflikte auf eine Weise bearbeiten können, das sich (fast) alle in den Ergebnissen aufgehoben fühlen. Natürlich muss die Organisation, die Größe und Dauer entsprechend angepasst sein.
(4) Verbindlichkeit von Bürgerräten
Frage: Was bringen Bürgerräte, wenn schon die Verbindlichkeit von Bürgerentscheiden in Frage gestellt wird?
Antwort: Die Hamburger Verfassung betrachtet die Bezirke als Verwaltungseinheiten und nicht als Kommunen. So kommt es nach jetziger Gesetzeslage vor, dass der Senat einen Bürgerentscheid evozieren kann. Im Gegensatz zu Bürgerentscheiden ist der Bürgerrat ein rein konsultatives Instrument und kann nur Empfehlungen in den politischen Prozess einbringen. Gerade bei den großen Fragen der Nachhaltigkeit müssen wir einfach mal was ganz Neues ausprobieren. Vielleicht kann man mit einer innovativen Enquete-Kommission auch die Querelen zwischen Bezirks- und Senatsebene hinter sich lassen.
(5) Repräsentativität
Frage: Wie kann denn ein ausgeloster Bürgerrat wirklich repräsentativ sein? Viele relevante Kriterien kann man doch gar nicht erheben.
Antwort: Die Repräsentativität hängt erstens mit der Größe des Gremiums zusammen. Ein Gremium von 5–7 Personen kann schwerlich die Bevölkerung repräsentativ abbilden. Anders als in Forschungsprojekten oder Umfragen, geht es hier aber darum, die wichtigsten demographischen Merkmale repräsentiert zu sehen, v.a. Geschlecht, Alter, Wohlgegend, Bildungsstand, Migrationshintergrund. Je schwieriger die Frage, desto größer sollte das Gremium sein. Es gibt Beispiele für nationale Bürgerräte von 100 bis sogar 900 Teilnehmer*innen. Es scheint, dass eine Größenordnung von 150 bis maximal 300 nicht überschritten werden sollte, damit die Teilnehmer*innen sich noch kennenlernen und sozial und moralisch den Prozess bewältigen. Für die Konsensfindung ist dies von großer Bedeutung.
Vergleicht man die Repräsentativität von Bürgerräten mit der deutscher Parlamente, so bilden sie die Bevölkerung recht gut ab. Die Abgeordneten im Bundestag sind zu 70% Männer und zu 20% Juristen und rekrutieren sich aus Parteimitgliedern, die lediglich 1,5% der Bevölkerung ausmachen.
Der von Mehr Demokratie initiierte Bürgerrat Demokratie umfasste 160 ausgeloste Bürger, der von BDI durchgeführte Bürgerdialog umfasste 3 x 70 ausgeloste Bürger*innen in drei Städten, der vom Bundestag geplante Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ soll ebenfalls 160 ausgeloste Bürger*innen umfassen.
(6) Qualität der Ergebnisse eines Bürgerrates
Frage: Warum sollten die Ergebnisse eines Bürgerrates qualitativ besser sein als die im Parlament gefundenen?
Antwort: Bürgerräte bestehen in der Regel ja nicht nur aus Bürger*innen, sondern wie bei Parlamenten oder Ausschüssen, werden je nach Bedarf Experten von außen oder aus der Verwaltung eingeladen und angehört. Welche Expert*innen gehört werden, kann ja mit dem Bürgerrat erörtert werden. Bewährt hat sich auch die Praxis, dass auch Politiker*innen für Fragen und als Beobachter zur Verfügung stehen, ohne dass sie an den Gesprächen aktiv teilnehmen. Aber in Irland haben sie in einem Bürgerrat ein Drittel der Teilnehmer ausgemacht.
Das Erfolgsgeheimnis der Bürgerräte liegt wesentlich darin begründet, dass sie nicht nach der Parteienlogik arbeiten: Regierung schlägt vor – Opposition ist aus Prinzip dagegen, oder umgekehrt. Regierung stellt etwas zur Abstimmung – Abgeordnete folgen der Fraktionsdisziplin, auch wenn sie im Einzelgespräch zugeben, dass sie anderer Meinung sind. In den parlamentarischen Ausschüssen, in denen auch Sachverständige gehört werden, nähern sich die Fraktionen zwar an, müssen aber ihr Profil wahren. Anders in den Bürgerräten, in denen sich die Teilnehmer ungebunden auf ein Thema konzentrieren können, sich sowohl sachlich als auch persönlich annähern und sogar ihre Meinung ändern können. So erreicht man in der Regel viel schneller einen Konsens.
Eine Empfehlung an die Politik, die so entstanden ist, muss die Politik zwar nicht befolgen, aber sie muss gute Gründe haben, es nicht zu tun und diese auch öffentlich darlegen.
(7) Bürgerräte anfällig für Lobbyismus?
Frage: Öffnen Bürgerräte nicht Tür und Tor für Lobbyisten? Werden da nicht bald neue Geschäftsmodelle für Lobbyismus entstehen, um die Bürgerräte zu beeinflussen?
Antwort: In Berlin kommen auf einen Bundestagsabgeordneten im Schnitt etwa 7–8 Lobbyisten, in Brüssel ca. 20–25. Abgesehen davon, dass Lobbyisten Bürgerräte aus rein organisatorischen Gründen nur schwer beeinflussen können (sie wissen ja nicht, wer ausgelost wird), schützt der abwägende Dialog vor solchen Einflüssen. Da müsste ein Lobbyist ja die Bürger*innen regelrecht verfolgen. Darüber hinaus macht es für Lobbyisten rein organisatorisch wenig Sinn, denn der direkte Zugang zur Politik ist doch viel einfacher. Für neue Geschäftsmodelle fehlt jeglicher Anreiz.
(8) Warum den Umweg über eine Enquete-Kommission?
Frage: Warum sollte man nicht gleich einen Bürgerrat Klimapolitik durchführen, statt den Umweg über eine Enquete-Kommission, die ein geschichtlich vorgeprägtes Gremium ist? Wir müssen den Prozess in Gang setzen. Wir haben doch keine Zeit mehr für eine jahrelange Enquete-Kommission.
Antwort: Die Enquete-Kommission hatte früher tatsächlich eine ganz andere Funktion als heute und wurde oft als ein Instrument für das Schieben auf die lange Bank oder Verhindern wahrgenommen. Im vorliegenden Vorschlag des Zukunftsrates hat die Enquete-Kommission die vorgeschaltete Frage zu stellen, welche Optionen für Bürgerbeteiligungen gibt es. Wir können nicht vorgeben, dies bereits zu wissen. Jede der heute bestehenden Formen hat seine Vor- und Nachteile, wie etwa das Kopplungsverbot bei Volksentscheiden, das das Thema auf eine punktuelle Fragestellung einschränkt. Wir haben aber komplexe Fragen der Nachhaltigkeit vor uns, die soziale, ökologische, demokratische und kulturelle Aspekte berühren. Wir haben also sowohl umfassende thematische als auch Verfahrensfragen zu beantworten. Hier ist nach unserer Auffassung ein Dialog zwischen Bürgerschaft, der organisierten Zivilgesellschaft und den Bürger*innen — vielleicht in Form von Bürgerräten nötig. Aber eine Enquete-Kommission und ein Bürgerrat für Klima schließen sich nicht gegenseitig aus.
Dem Vorschlag zufolge, soll die Enquete-Kommission dieses Mal eine in jeder Hinsicht innovative sein. Einen weiteren Vorteil sieht der Zukunftsrat darin, dass die Hamburger Verfassung eine Enquete-Kommission ausdrücklich für komplexe Fragen vorsieht und man daher nicht auf eine Verfassungsänderung warten muss. Bezüglich der detaillierten Zusammensetzung lässt die Verfassung erhebliche Spielräume und man kann ohne Verzug beginnen. So kann die Enquete-Kommission eine Kupplungsrolle zwischen dem Parlament und Zivilgesellschaft und den Bürger*innen einnehmen, gerade weil alles andere ja bisher unbefriedigend gewesen ist.
(8) Warum noch eine weiteres Beteiligungsgremium?
Frage: Es gibt doch schon so viele Beteiligungsgremien in der Stadt, Beiräte für Stadtteile, für Jugend, sogar einen Landesjagdtbeirat. Häufig weiß man von deren Existenz zwar nichts, sie veröffentlichen nichts. Anderswo mögen sie vielleicht gut funktionieren. Sie bewegen aber nichts, überall nimmt man Frustration wahr. Müssten wir nicht erst einmal grundsätzlich einmal überlegen, wohin wir in dieser Gesellschaft mit der Mitbestimmung hinwollen?
Antwort: Genau mit dieser grundsätzlichen Frage soll sich ja die Enquete-Kommission befassen und sich mit den verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung auseinandersetzen. Die Gremien sollen in ihrer Zusammensetzung, in ihrer Größe, ihren Verfahren und in ihrer Dauer möglichst gut auf die zu adressierenden Fragestellungen zugeschnitten sein. Genau das herauszufinden sollte die Aufgabe der Kommission sein. Dort wo bereits funktionierende Beteiligungsformen gegeben sind, sollen sie nicht abgeschafft werden. Vielleicht gibt es aber Ideen, wie man sie noch weiter entwickeln kann.
(9) Bürgerräte sind nicht für alles geeignet
Frage: Die Diskussion hat sich stark auf die Enquete-Kommission und auf Bürgerräte konzentriert. Sie können sinnvoll sein, aber sind auch mit Aufwand verbunden. Wenn es darum geht, Bürger*innen im Alltag Gehör zu verschaffen, wo viele Fragen im sozialen Raumvorkommen, sind Bürgerräte nicht umsetzbar. Man muss auch auf andere Formate schauen.
Antwort: Richtig. Es geht nicht darum, funktionierende Formate außer Kraft zu setzen, sondern Ansätze dort zu finden, wo die Lösungen bisher nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren.
(10) Wie sieht so ein Bürgerrat in der Regel aus? Wie funktioniert er?
Bürgerrat ist ein sehr flexibles Instrument, das auf die Fragestellung und auf die Umstände zugeschnitten werden kann und muss. Daher gibt es für sie kein einheitliches Modell. Es variiert von Land zu Land, von Fall zu Fall. Es gibt Bürgerräte, die nur aus ausgelosten Bürgern bestehen, aber auch andere Modelle.
Typischerweise beginnt ein Bürgerrat mit einer Eröffnungsphase, wo sich die Moderation vorstellt, den Bürger*innen die Fragestellung und den Ablauf erläutert. Es wir geklärt, welche Sachverständigen nach welchen Kriterien ausgewählt und eingeladen werden.
Auch die Dauer variiert, aber man sollte sich Zeit lassen, wenn es um wichtige Fragestellungen geht. Man muss sich im Laufe des Bürgerrats in das Thema einarbeiten können. Bei umfassenden Fragen kann sich ein Bürgerrat ein ganzes Jahr lang treffen, aber idealerweise sollte es wenigstens ein halbes Jahr sein. Wenn Anreise nötig ist, trifft man sich an Wochenenden, damit auch Berufstätige teilnehmen können, oft z. B. einmal im Monat. Ideal ist, wenn die Bürger*innen dafür eine Entschädigung erhalten und für etwa für Pflege oder Aufsicht von Familienangehörigen die Kosten übernommen werden. Bürgerräte kosten also auch Geld, das sollte man nicht vergessen. Auch für eine gute Moderation und Raummiete muss Finanzierung vorhanden sein.
Das Ergebnis eines Bürgerrates im einfachsten Fall eine einfache Liste von Ratschlägen sein. Bei dem Bürgerrat Demokratie wurde eine Liste von 22 Vorschlägen erarbeitet, über die die Bürgerratsteilnehmer abstimmten. Die Liste wurde mit den jeweils abgegebenen Stimmen an den Bundestag überreicht. Sehr beliebt sind Bürgergutachten, in denen sich die Teilnehmer auf bestimmte Formulierungen von Empfehlungen im Konsens einigen. Für die Einigung gibt es auch verschiedene Verfahren, wie z. B. das Konsensieren.
Ein Bürgerrat ist konsultativ und kann nur empfehlen. Das Ergebnis kann in den üblichen parlamentarischen Prozess zugeführt werden, es kann zusätzlich eine Bürgerumfrage über die Empfehlungen vorgenommen werden oder ein Referendum. Entscheidend ist, dass von Anfang an eine wie auch immer gestaltete Pflicht der Politik besteht, das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen und damit auf verabredete Weise umzugehen. Wenn diese Klarheit nicht vorliegt, dann sollte man mit einem Bürgerrat erst gar nicht anfangen. Denn wenn ein Bürgerrat tolle Ergebnisse zeitigt und diese einfach verpuffen, ist großer Frust die Folge und das ist schlimmer als gar kein Bürgerrat.